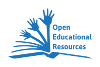Theogonie
Die Theogonie entstand durch den griechischen Dichter Hesiod. http://www.alaturka.info/images/images_content/kultur/musik/hesiod-2.jpg Er schilderte die Entstehung der Welt und der Götter. Außerdem schilderte er auch die Götterherrschaft. Die Theogonie ist einer der ältesten Quellen der Griechischen Mythologie neben der Odyssee und der Ilias.
Historische Entwicklung des Begriffs [Bearbeiten]
Der Begriff theologia tritt bereits in der griechischen Antike auf. Dort bezeichnete Theologie die „Rede von Gott“, das Singen und Erzählen (gr. „mythein“) von Göttergeschichten. (Später verstanden Theologen wie Karl Barth z. B. unter diesem Begriff: „Gottes Rede zu den Menschen“.) Der älteste Beleg für dieses mythische Verständnis von Theologie findet sich in Platons Staat (379a). Platon legt an die Göttermythen der kritisierten Theologie den kritischen Maßstab der Frage nach der Wahrheit als dem Einen, Guten und Unveränderlichen an. Bei Aristoteles zeigt sich dann eine Umprägung des Theologiebegriffs: Theologie als die oberste der theoretischen Wissenschaften richtet sich hier nun auf das Göttliche als dem ersten und eigentlichen Prinzip (Metaphysik (Aristoteles) 1064a/b). Die Theologie hat sich damit von der Mythologie hin zur Metaphysik gewandelt. Bereits im zweiten Jahrhundert wird der Begriff von christlichen Autoren, den sogenannten Apologeten, aufgegriffen, die ihn nun im Kontrast zur mythologia (Erzählen von Göttergeschichten) der polytheistischen heidnischen Autoren verwendeten. Bei Eusebius bedeutet der Begriff dann etwas wie „das christliche Verständnis von Gott“. Bei allen patristischen Autoren bezog sich der Begriff jedoch nicht auf die christliche Lehre im Allgemeinen, sondern nur auf die Aspekte von ihr, die sich direkt auf Gott bezogen. So wurden als einzige frühchristliche Autoren der Autor des Johannesevangeliums und Gregor von Nazianz spezifisch als „Theologen“ bezeichnet, weil Gott bei ihrer Lehre im Mittelpunkt stand. Die Fragen nach dem Heilshandeln und der Heilsordnung Gottes für die Menschen wurden unter dem Begriff der Ökonomie (gr. „oikonomia“) behandelt. Christliche Theologen in der Alten Kirche waren häufig Bischöfe, im Mittelalter in der Regel Ordensleute. Mit der Entstehung der Universitäten als Ordenshochschulen im Mittelalter bildete die Theologie meist die erste Fakultät. Im Hochmittelalter bekam der Begriff dann bei Peter Abaelard (Frühscholastik) und Bonaventura (Hochscholastik) erstmals die allgemeinere Bedeutung „das Gebiet des heiligen Wissens“, das die gesamte christliche Lehre umfasste. Zum feststehenden Begriff in diesem Sinn wurde Theologie dann insbesondere aufgrund der Summa theologica von Thomas von Aquin, der Theologie in erster Linie als spekulative, theoretische Wissenschaft ansah. Die Reformatoren betonten dann den praktischen Aspekt der Theologie wieder stärker. Damit steht Martin Luther auch in der Tradition der monastischen Verankerung der Theologie wie sie im Mittelalter z. B. bei Anselm von Canterbury und Bernhard von Clairvaux wirksam war. Praktische Wissenschaft war die Theologie in dem Sinne, dass sie ganz auf die Zueignung des Heils durch Gott, also den praktischen Vollzug des Glaubenslebens bezogen war. In diesem Sinne bestimmten auch zahlreiche Vertreter der lutherischen Orthodoxie die Theologie als eine scientia practica, die allerdings in ihrer Durchführung auch Anleihen bei der theoretischen Wissenschaft machen müsse. Deshalb gewannen die theologischen Systeme der lutherischen Orthodoxie vielfach äußerlich einen ähnlichen Charakter wie die alten scholastischen Summen, waren inhaltlich aber anders angelegt und auch in ihrem systematischen Aufbau (der sich an den analytischen ordo des Aristoteles anlehnte) stärker auf die Glaubenspraxis hin ausgerichtet. Teilweise etablierte sich auch wieder ein stärker oder gar rein theoretisches Verständnis der Theologie. Die Unterscheidung der Theologie als Wissenschaft von der Glaubenspraxis und der unmittelbaren Erkenntnis des Glaubens wurde schon zur Zeit der lutherischen Orthodoxie durch den Theologen Georg Calixt vorbereitet. In Ansätzen liegt sie auch bei Abraham Calov und Johann Andreas Quenstedt vor. Während diese allerdings die Theologie dem Glauben vorordnen, wird das Verhältnis in der Aufklärung umgekehrt: Die Theologie ist als Reflexionsform gegenüber dem Glauben bzw. der Religion sekundär. Diese Verhältnisbestimmung tritt erstmals bei Johann Salomo Semler auf. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher begriff die Theologie dann als eine positive Wissenschaft, die auf die Kirchenleitung bezogen ist. Während die Unterscheidung von Theologie und Glaube bis heute für den theologischen Diskurs maßgeblich ist, bleibt die Ausrichtung der Theologie auf die Kirchenleitung umstritten.
(Charlotte& Katrin& Francesca)